Die Ottawa-Konvention - Das Verbot von Antipersonen-Minen
Die Ottawa-Konvention (auch Ottawa-Abkommen) ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Sie verbietet Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonen-Minen und verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Opferhilfe.
Die Konvention zählt über 160 Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland. Wichtige Länder wie die USA, Russland und China fehlen. Sie trat 1999 in Kraft - nach einem langen und erfolgreichen Kampf durch die internationale Zivilgesellschaft.
Handicap International war Mitgründerin der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen, die für ihr Engagement gegen Landminen den Friedensnobelpreis erhielt.
Das lesen Sie auf dieser Seite
- Warum wurden Antipersonen-Minen verboten?
- Was steht im Ottawa-Abkommen?
- Stärken und Schwächen des Ottawa-Abkommens
- Erfolge des Minenverbots
- Der Ottawa-Prozess: Auf dem Weg zum Ottawa-Vertrag
- Friedensnobelpreis
- Welche Länder haben Antipersonen-Minen verboten
- Welche Länder haben Antipersonen-Minen noch nicht verboten
- Die Ottawa-Konvention heute
- Minenfrei bis 2025?
Warum wurden Antipersonen-Minen verboten?
1999, als das Minenverbot in Kraft trat,
- gab es noch 88 kontaminierte Staaten,
- waren bis zu 110 Mio. Minen weltweit vergraben,
- lagerten Armeen rund 155 Millionen Antipersonen-Minen,
- gab es jährlich über 20.000 Opfer dieser Waffen.
Der Handlungsbedarf war enorm und Millionen Menschen weltweit unterstützten ein umfassendes Verbot von Landminen.
► Lesen Sie alles über Antipersonen-Minen in unserem Hauptartikel
Was steht im Ottawa-Abkommen?
Das Ottawa-Abkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Es verbietet seinen Mitgliedsstaaten Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonen-Minen und verpflichtet sie zur Opferhilfe und zur Minenräumung.
Konkret bedeutet das:
- Staaten dürfen Antipersonen-Minen niemals verwenden, produzieren, herstellen, kaufen, lagern (außer zu Trainingszwecken) oder weitergeben.
- Sie müssen sämtliche gelagerten Antipersonen-Minen innerhalb von vier Jahren vernichten
- und alle Minenfelder in ihrem Hoheitsgebiet innerhalb von 10 Jahren räumen.
- Ist ihr Land von Minen betroffenen, müssen sie die Bevölkerung über die Gefahren aufklären und kontaminierte Gebiete markieren.
- Menschen, die Opfer von Minenunfällen geworden sind, müssen die Staaten bei der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung und der Rehabilitation unterstützen
- Die Vertragsstaaten müssen sich gegenseitig helfen, etwa bei der Opferhilfe oder beim Minenräumen.
- Damit das Minenverbot auch wirklich umgesetzt wird, müssen die Staaten entsprechende Gesetze, Vorschriften etc. einführen
- und um dem Verbot Aufschwung zu geben, müssen die Staaten jährlich ihre Fortschritte berichten.
► Hier gelangen Sie zum vollständigen Vertragstext.
Stärken und Schwächen des Ottawa-Abkommens
Das Ottawa-Abkommen war bahnbrechend. Es rettete tausende Menschenleben und führte zur Vernichtung von Millionen von Antipersonen-Minen. Es veränderte aber auch das gesamte internationale Gefüge und hatte einen großen Einfluss auf alle zukünftigen internationalen Verhandlungen.
Das Abkommen veränderte den Blickwinkel beim Einsatz von Minen: weg vom militärischen Nutzen hin zu humanitäre Erwägungen. Es setzte außerdem neue Standards für die Abrüstung. Und es zeigte auf beeindruckende Weise, welche positive Macht multilaterale Zusammenarbeit und zivilgesellschaftliche Engagement entfalten können und wie sie globale Normen gestalten und verändern können.
Stärken des internationalen Verbots von Antipersonen-Minen
- Umfassendes Verbot: Die Ottawa-Konvention war der erste internationale Vertrag, der den Einsatz, die Lagerung, die Herstellung und die Weitergabe von Antipersonen-Minen umfassend verbot. Es gab zwar davor auch schon Versuche, Landminen einzudämmen, diese waren aber nur mäßig erfolgreich.
- Stigmatisierung von Minen: Der Vertrag trug zur Stigmatisierung von Minen bei. Der Vertrag drehte die Rechtfertigung von Staaten und Militärs völlig um. Auf einmal mussten nicht mehr die Gegner begründen, wieso sie gegen diese Waffen waren. Nun mussten Politik und Militärs rechtfertigen, wieso sie an ihnen festhielten. Der Vertrag schärfte damit Bewusstsein für die verheerenden Auswirkungen von Antipersonen-Minen auf die Zivilbevölkerung und schuf eine moralische Verpflichtung für Staaten, Maßnahmen zu ergreifen. Er führte außerdem dazu, dass auch Staaten, die dem Verbot nicht beigetreten waren, wie die USA, ihren Umgang mit den Waffen änderten.
- Humanitärer Schwerpunkt: Die Ottawa-Konvention legte einen starken Schwerpunkt auf humanitäre Überlegungen: weg vom militärischen Nutzen - hin zu den Bedürfnissen der Menschen. Menschen müssen sicher, ohne Angst und mit Zukunftsperspektiven leben können. Deshalb verbietet die Konvention nicht nur den Einsatz von Antipersonen-Minen, sondern verpflichtet auch zu Minenräumung, der Opferhilfe und der Unterstützung betroffenen Menschen.
- Einbindung der Zivilgesellschaft: Die Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft, wie der von Handicap International mitgegründet Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen (ICBL), spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Vertrags. Die ICBL und ihre Mitgliedsorganisationen schafften es, den oben genannten humanitären Schwerpunkt zu setzen und so die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung in den Mittelpunkt des Vertrags zu rücken. Außerdem trug diese weltweite Kampagne den Willen der Zivilgesellschaft in die Verhandlungen. Sie ist deshalb ein beeindruckendes Beispiel für die Macht kollektiven Handelns und zeigt, wie Graswurzelbewegungen internationaler Normen mitgestalten können. Seit diesem Erfolg ist die Zivilgesellschaft ein fester Teil internationaler Verhandlungen.
- Universelle Beteiligung: Die Ottawa-Konvention fand breite internationale Unterstützung. Sie wurde von einer großen Anzahl von Staaten unterzeichnet und gewann im Ratifizierungsprozess an Dynamik. Alle Staaten konnten sich an dem Prozess beteiligen. Und das starke Engagement einiger besonders motivierter Staaten stellte sicher, dass der Vertrag nicht verwässert würde. Diese besonders motivierten Staaten waren häufig eher kleinere Staaten, die sonst auf dem politischen Parkett wenig zu sagen hatten, wie Irland, Kanada oder Österreich. Doch im Zusammenschluss mit der Zivilgesellschaft und betroffenen Ländern wehrten sie Blockadehaltungen vieler andere Staaten erfolgreich ab.
- Langfristige Auswirkungen: Das Minenverbot inspirierte nachfolgende Abrüstungs- und humanitäre Verträge und es verschaffte der Zivilgesellschaft einen Platz am Verhandlungstisch bei zukünftigen internationalen Verhandlungen. Und es beflügelte weitere Kampagnen, wie die zum Verbot von Streumunition - aber auch Kampagnen zu ganz anderen humanitären Themen nahmen sich die Erfolge des Minenverbots zu Herzen.
Was sind die Schwächen des Landminenverbots?
Das Landminenverbot ist ein Meilenstein im Völkerrecht zum Schutz der Bevölkerung vor Minen. Es verbietet den teilnehmenden Staaten Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonen-Minen. Außerdem sind sie dazu verpflichtet, den Überlebenden zu helfen und ihre Minen zu räumen. Dennoch weist es einige Schwächen auf:
- Antifahrzeug-Minen weiterhin erlaubt: Die Ottawa-Konvention konzentriert sich ausschließlich auf Antipersonenminen. Antifahrzeug-Minen sind nicht verboten. Dadurch entsteht eine große Lücke bei der Bewältigung der humanitären Auswirkungen von Landminen. Ein universelles Landminenverbot wäre sehr erstrebenswert gewesen. Denn auch Antifahrzeug-Minen sind gefährlich für die Zivilbevölkerung und sie verhindern die Wiederaufbaumaßnahmen nach Konflikten.
- Fehlende universelle Beteiligung: Trotz einer sehr, sehr breiten Unterstützung haben nicht alle Länder die Ottawa-Konvention ratifiziert oder sind ihr beigetreten. Einige bedeutende Militärmächte und von Minen betroffene Staaten, wie China, Russland und die Vereinigten Staaten, sind dem Vertrag nicht beigetreten. Zwar ist die Zahl massiv gesunken, aber noch immer werden in manchen Ländern Minen hergestellt.
- Nicht-staatliche bewaffnete Gruppen: Das Ottawa-Übereinkommen konzentriert sich in erster Linie auf staatliche Akteure und lässt nicht-staatliche bewaffnete Gruppen außerhalb des rechtlichen Rahmens. Diese Gruppen, die häufig APM einsetzen, stellen weiterhin eine Bedrohung für die Zivilbevölkerung dar und können die Ziele des Übereinkommens untergraben.
- Mangel an klaren Durchsetzungsmechanismen: Dem Minenverbot fehlt ein starker Durchsetzungsmechanismus. Die Staaten werden zwar aufgefordert, über ihre Fortschritte zu berichten, doch gibt es keine Strafen oder Sanktionen für die Nichteinhaltung.
- Aufbewahrung von Lagerbeständen für Ausbildung und Forschung: Die Konvention erlaubt es den Staaten, Antipersonen-Minen für Ausbildungs- und Forschungszwecke aufzubewahren. Nur wenn diese Waffen vollständig vernichtet werden, können Sie nicht mehr eingesetzt werden.
- Veränderte Art der Kriegsführung: Das Ottawa-Übereinkommen konzentriert sich in erster Linie auf traditionelle Antipersonen-Minen und geht nicht auf neue Technologien und improvisierte Sprengkörper (IEDs) ein, die ähnlich wie Antipersonen-Minen funktionieren können. Die begrenzte Anpassungsfähigkeit des Übereinkommens an neue Formen von Sprengkörpern stellt eine Herausforderung dar, wenn es darum geht, der sich entwickelnden Art der Kriegsführung wirksam zu begegnen.
- Opferhilfe kommt zu kurz: Das Ottawa-Übereinkommen erkennt zwar die Bedeutung der Opferhilfe an, doch muss die Bereitstellung umfassender und nachhaltiger Hilfe für Minenüberlebende und betroffene Gemeinden stärker betont und unterstützt werden. In den letzten Jahren machte die Opferhilfe am wenigsten Fortschritte, im Vergleich mit anderen Bereichen so genannter „Minenaktion“. Immer noch gibt es zu wenig langfristige Unterstützung für die Überlebenden von Minenunfällen, die mit Behinderungen weiterleben müssen. Diese Maßnahmen sind von Geldkürzungen leider besonders betroffen.
- Trotz dieser Schwächen bleibt das Ottawa-Übereinkommen das wichtigste internationale Instrument zur Bekämpfung der humanitären Auswirkungen von Antipersonenminen.
Erfolge des Minenverbots
- Weniger Opfer: Das Minenverbot hat eine drastische Senkung der Opferzahlen bewirkt - dank Minenräumung und Minenaufklärungskampagnen. Leider ist die Zahl der Opfer, besonders durch Konflikte in Syrien, Irak, Jemen und durch den Einsatz von improvisierten Sprengsätzen in den letzten Jahren wieder in die Höhe gegangen. Doch im Vergleich zu mehr als 20.000 Opfern jährlich vor 1999 sind die Zahlen mit unter 5.000 im Jahr 2022 (letztes Berichtsjahr des Landmine-Monitor) immer noch wesentlich niedriger.
- Zerstörung von Lagerbeständen: Offiziell wurden bisher weltweit mehr als 55 Mio. Antipersonenminen zerstört. Fast alle Vertragsstaaten haben ihre Bestände zerstört und behalten nur noch Exemplare für Testzwecke. Nur noch die Vertragsstaaten Ukraine und Griechenland lagern erhebliche Mengen (Stand 2022): 3,4 Mio. und 343.413. 1999 schätze der Monitor, dass die Nichtunterzeichnerstaaten zusammen über 160 Mio. Landminen lagerten. Heute wird von einem weltweiten Bestand von unter 50 Mio ausgegangen. Fast die Hälfte davon in Russland.
- Räumung von Minenfeldern: Mehr als 30 Länder und Gebiete wurden als landminenfrei erklärt. Nur noch in rund 60 Länder weltweit liegen Minen
- Stigmatisierung: Staatliche Armeen setzen Anti-Personen-Minen fast nicht mehr ein, das Minenverbot hat auch für die Nicht-Unterzeichner-Staaten eine abschreckende Wirkung und es ist kaum noch legaler Handel zu verzeichnen.
Der Ottawa-Prozess: Auf dem Weg zum Ottawa-Vertrag
Als Ottawa-Prozess werden eine Reihe von diplomatischen Verhandlungen und Konferenzen bezeichnet, die in den 1990er Jahren stattfanden und zur Annahme der Ottawa-Vertrag führten, dem Verbot von Antipersonen-Minen.
In diesem Prozess arbeiteten Regierungen, internationalen Organisationen, UN-Organisationen und die Zivilgesellschaft, vertreten durch die Internationale Kampagne für ein Verbot von Landminen (ICBL) ungewöhnlich eng zusammen.
Der Erfolg sollte ihnen Recht geben, denn am Ende waren Minen von einer Vielzahl an Staaten verboten.
ICBL: die internationale Kampagne für ein Verbot von Landminen
Die ICBL (International Campaign to Ban Landmines) ist ein weltweites Netzwerk von NGOs, das sich für ein universelles Verbot von Landminen einsetzt.
Die ICBL wurde 1992 von sechs Organisationen gegründet, darunter Handicap International und medico. Gemeinsam mit Partnerstaaten und UN-Organisationen schaffte sie es, dass ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft Antipersonen-Minen verbot.
Heute überwacht die ICBL die Einhaltung des der Ottawa-Konvention, kämpft für eine weitere Universalisierung der Konvention und setzt sich für die Belange der Überlenden von Unfällen mit Landminen ein.
Friedensnobelpreis
1997, als das Minenverbot zustande kam, erhielt die Kampagne den Friedensnobelpreis. Nie zuvor sei es gelungen, eine Waffe zu verbieten, die überall in der Welt im Gebrauch sei. Das Nobelpreiskomitee hob außerdem hervor, dass die Kampagne nicht nur eine wichtige Rolle beim Erreichen eines Vertrages gespielt, sondern auch eine neue Form der internationalen Diplomatie vorangebracht habe. Trotz Widerstandes der Militärgroßmächte und außerhalb der gängigen UNO-Strukturen haben mittlere und kleine Staaten im Bündnis mit der "organisierten Zivilgesellschaft" Erfolge erzielt, die sie allein nie erreicht hätten.
Lesen Sie weiter:

Die Kampagne rettete Tausende Menschenleben. Den Friedensnobelpreis hatte sie deshalb mehr als verdient.
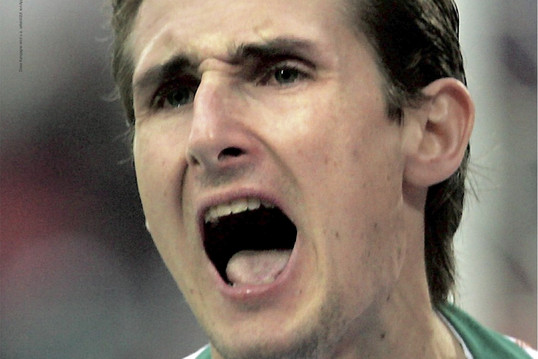
Die deutsche Kampagne sammelte über 450.000 Unterschriften gegen Landminen und wurde von zahlreichen Prominenten unterstützt.
Welche Länder haben Antipersonen-Minen verboten
164 Staaten (Stand 2023) haben weltweit Antipersonen-Minen verboten. Sie haben die Ottawa-Konvention ratifiziert oder sind ihr später beigetreten. Unter den fehlenden Ländern sind die USA, Russland, China und andere.
Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cook Inseln, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Großbritannien, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Nord Mazedonien, Mexiko, Moldau, Monaco, Montenegro, Mosambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Niue, Norwegen, Oman, Österreich, Palau, Palästina, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Solomon Inseln, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zentralafrikanische Republik, Zypern
*die Marshall Islands haben den Landminen-Verbots-Vertrag zwar unterschrieben, jedoch noch nicht ratifiziert
Welche Länder haben Antipersonen-Minen noch nicht verboten
Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, China, Georgien, Indien, Iran, Israel, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Laos, Libanon, Libyen, Marokko, Mikronesien, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Syrien, Tonga, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vietnam
32 Länder haben Antipersonen-Minen noch nicht verboten. Aber auf viele dieser Staaten hat der Ottawa-Vertrag dennoch eine starke Wirkung. So haben die USA zum Beispiel de facto Antipersonen-Minen verboten - nur auf der koreanischen Halbinsel dürfen sie theoretisch noch eingesetzt werden.
Die Ottawa-Konvention heute
Der Ottawa-Vertrag ist ein Meilenstein - aber er ist nur ein besonders wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Welt, in der alle Menschen ohne Gefahr vor Landminen leben können. Hilfsorganisationen wie Handicap International räumen Minen, versorgen die Überlebenden und klären die Bevölkerung in der Nähe von Minenfeldern auf.
Doch nur wenn alle Staaten weltweit alle Minen verboten haben - und alle betroffenen Staaten ihre Länder geräumt haben, wird die Gefahr gebannt sein. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Die Konvention hat dafür einige wichtige Instrumente geschaffen:
Konferenzen
Einmal im Jahr findet das offizielle Treffen der Vertragsstaaten des Ottawa Abkommens statt. Zwischen den jährlichen Hauptkonferenzen im November findet jeweils eine Zwischentreffen statt. Alle fünf Jahre findet eine Überprüfungskonferenz statt. Das annual meeting findet abwechselnd in Genf und einem betroffenen Land statt. Die intersessional meetings finden in Genf statt. Die review conference findet fast immer in einem betroffenen Land statt.
Zu den Treffen kommen Vertreter*innen von Vertragsstaaten, ICBL, wichtigen Hilfsorganisationen wie Handicap International, UN-Organisationen sowie von beobachtenden Staaten.
Die Teilnehmer*innen besprechen die Fortschritte bei der Universalisierung und Umsetzung des Minenverbotsvertrags und reden über Herausforderungen.
Die Konferenzen sind ein zentraler Faktor für den Erfolg der Ottawa-Konvention. Da ihr echte Durchsetzungsmechanismen fehlen, kann über den sozialen Druck auf diesen Treffen viel erreicht werden. Bei jeder Konferenz sprechen Überlebende von Unfällen mit Landminen von ihrem Schicksal und reden der Politik ins Gewissen. Die Treffen sind außerdem ein einmaliger Ort zur Vernetzung.
Liste der annual meetings und review conferences und der austragenden Orte:
- 3. bis 7. Mai 1999: Maputo, Mosambik
- 11. bis 15. Sept. 2000: Genf, Schweiz
- 18. bis 21. Sept. 2001: Managua, Nicaragua
- 16. bis 20. Sept. 2002: Genf, Schweiz
- 15. bis 19. Sept. 2003: Bangkok, Thailand
- 29. Nov. bis 3. Dez. 2004: Nairobi, Kenia - 1. Gipfeltreffen
- 18. bis 22. Sept. 2006: Genf, Schweiz
- 18. bis 21. Sept. 2007: Totes Meer, Jordanien
- 24. bis 28. Nov. 2008: Genf, Schweiz
- 29. Nov. bis 4. Dez. 2009: Cartagena, Kolumbien - 2. Gipfeltreffen
- 28. Nov. bis 3. Dez. 2010: Genf, Schweiz
- 28. Nov. bis 2. Dez. 2011: Phnom Penh, Kambodscha
- 03. Dez. bis 7. Dez. 2012: Genf, Schweiz
- 2. bis 5. Dez. 2013: Genf, Schweiz
- 23. bis 27. Jun. 2014: Maputo, Mosambik - 3. Gipfeltreffen
- 30. Nov. bis 4. Dez. 2015: Genf, Schweiz
- 28. Nov. bis 1. Dez. 2016: Santiago, Chile
- 18. bis 21. Dez. 2017: Wien, Österreich
- 26. bis 30. Nov. 2018: Genf, Schweiz
- 16. bis 20. Nov. 2020: Genf, Schweiz (virtuell wegen Covid-19)
- 29. Nov. bis 3. Dez. 2021: Noordwijk, Niederlande
- 21. Nov. bis 25. Nov. 2022: Genf, Schweiz
- 20. Nov. bis 24. Nov. 2023: Genf, schweiz
Der Landmine-Monitor
Auf den Hauptkonferenzen wird auch der jährliche Landmine-Monitor vorgestellt. Er ist die zentrale Stelle, bei der sämtliche Daten zum Fortschritt des Minenverbots zusammen laufen.
Der Monitor ist Teil der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen. Expert*innen aus aller Welt tragen seit 1998 akribisch die aktuellsten und relevantesten Informationen zur Umsetzung des Verbots von Antipersonen-Minen zusammen. Er sammelt
- sämtliche offiziellen Meldungen über Unfälle,
- macht neue Einsätzt von Landminen öffentlich,
- listet die Fortschritte bei der Entminung und bei der Vernichtung von Lagerbeständen auf,
- klärt über das Engagement der Staaten in Bezug auf die Opferhilfe auf,
- und macht deutlich, was noch getan werden muss.
► Lesen Sie hier die aktuellsten Fakten aus dem Landminen-Monitor
Minenfrei bis 2025?
Die Vertragsstaaten haben sich 2014 dazu verpflichtet, bis 2025 alle Antipersonenminen zu räumen. Ist das realistisch?
- Der Abschluss der Räumung bis 2025 könnte ein erreichbares Ziel in vielen Ländern sein.
- Der Erfolg hängt ab von der erneuerten und nachhaltigen finanziellen (und logistischen) Unterstützung durch internationale Geber sowie nationale Haushalte.
- Nicht so schnell erreichbar ist das Ziel in aktuellen Krisen- und Kriegsgebieten in denen durch die anhaltenden gewaltsamen Auseinandersetzungen Gebiete nicht geräumt werden können oder diese neu kontaminiert werden.
Lesen Sie weiter:
Portraits aus unseren Ausstellungen
In Zusammenarbeit mit dem Journalisten und Fotografen Till Mayer haben wir zwei Ausstellung konzipiert, die deutschlandweit verliehen werden. "Barriere:Zonen" und "erschüttert" erzählen bewegende Geschichten von Menschen aus Krisengebieten, von denen viele eine Behinderung haben. Lesen Sie hier Ihre Geschichten.

Jennifer Diaz Gonsalez sucht im Regenwald Kolumbiens nach Minen. Die junge Frau hat gute Gründe zu kämpfen: Ihre Tochter soll ohne Angst aufwachsen.

Mirsad Tokic ist sich sicher: Wären Menschenleben wichtiger gewesen als Profit, hätte er heute noch sein Bein und seine Kollegen.









